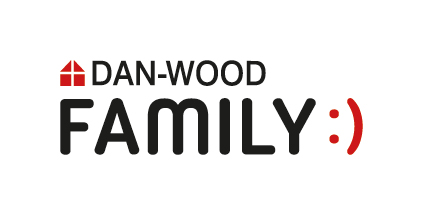Redaktion: Rebecca Frick
Nicht immer ist eine Außendämmung der Fassade möglich – etwa bei denkmalgeschützten oder historischen Gebäuden, deren äußeres Erscheinungsbild bewahrt werden soll. In solchen Fällen bleibt nur die Innendämmung. Diese kann jedoch anspruchsvoll sein, weil sie tief in die bauphysikalischen Eigenschaften des Hauses eingreift. Richtig ausgeführt, lässt sich damit aber ein guter Wärmeschutz erreichen, ohne den Charakter des Gebäudes zu verändern. Alte Häuser sind selten gerade und gleichmäßig. Häufig finden sich unregelmäßige Bruchsteinmauern, Mischmauerwerk, Nischen, Fachwerk oder Holzbalken. Diese Unebenheiten erschweren eine gleichmäßige Dämmung und bergen das Risiko von Wärmebrücken – also Stellen, an denen Wärme leichter nach außen entweicht. An solchen Übergängen kann sich Feuchtigkeit sammeln und Schimmel bilden, wenn die Dämmung nicht sorgfältig angepasst ist.



Checkliste: Worauf Sie bei der Planung achten sollten
- Gründliche Bestandsanalyse: Vor Beginn sollte ein Fachplaner oder eine Energieberaterin die Bausubstanz untersuchen. Nur so lässt sich feststellen, welche Materialien und Schichtaufbauten vorhanden sind und wie feucht das Mauerwerk ist.
- Diffusionsoffene Materialien wählen: Diese lassen Feuchtigkeit durch die Wand hindurch diffundieren und verhindern, dass sich Kondenswasser staut. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Kalziumsilikat oder Lehmputzsysteme sind oft vorteilhaft, weil sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
- Wärmebrücken vermeiden: Übergänge zu Decken, Böden und Innenwänden müssen sorgfältig ausgeführt werden. Schon kleine Lücken oder Spalten können die Dämmwirkung stark beeinträchtigen.
- Feuchteschutz planen: Eine Innendämmung verändert das Temperatur- und Feuchteverhalten einer Wand. Ein bauphysikalischer Nachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) hilft, Risiken früh zu erkennen.
- Lüftung und Heizung anpassen: Nach der Dämmung verändert sich das Raumklima. Eine kontrollierte Lüftung – ob manuell oder mit Technik unterstützt – hilft, Feuchtigkeit aus den Räumen zu führen.



Tipps aus der Sanierungspraxis
Gerade bei Altbauten lohnt es sich, mit Bedacht und in kleinen Schritten vorzugehen. Kleine Musterflächen oder Proberäume sind eine gute Möglichkeit, Erfahrungen mit den gewählten Materialien zu sammeln. So lässt sich prüfen, wie sich Dämmplatten, Putz oder Lehm beim Verarbeiten verhalten und ob die geplante Schichtstärke und Oberflächenwirkung zum Gebäude passen. Bei Fachwerkhäusern sollte die Dämmung möglichst flexibel bleiben. Holz arbeitet über das Jahr hinweg – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus und zieht sich bei Trockenheit zusammen. Eine anpassungsfähige, elastische Dämmschicht kann diese Bewegungen mitgehen, ohne dass Risse oder Hohlräume entstehen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Innenecken, Fensterlaibungen und Anschlüsse an Decken oder Balken. Hier entstehen schnell Wärmebrücken, wenn die Dämmung nicht passgenau ausgeführt wird. Sorgfältiges Zuschneiden, fugenfreies Anarbeiten und ein konsequent diffusionsoffener Aufbau helfen, Energieverluste und Feuchteansammlungen zu vermeiden. Eine ergänzende Wandheizung kann die Sanierung zusätzlich unterstützen. Sie sorgt für angenehm temperierte Wandoberflächen, reduziert das Risiko von Schimmelbildung und verbessert das Raumklima. In Verbindung mit einer diffusionsoffenen Innendämmung arbeitet sie besonders effizient und gleichmäßig.
- Sanierung einer HolztreppeArchitektin und Maklerin Nadine Fischer sanierte zusammen mit einem Malerbetrieb eine Villa in Hamburg-Ohlsdorf. Das Ergebnis: Ein Meisterstück in Sachen Energiebilanz und Gestaltung.
- Sanierung mit WärmepumpenkaskadeViele Mehrfamilienhäuser werden noch mit fossilen Energien beheizt, doch ein Beispiel aus Ochtendung zeigt Einsparpotenziale durch den Einsatz der Wärmepumpe.
- Holz, Stahl oder kombiniert? Materialvielfalt bei TreppenStillvolle und langlebige Treppenmaterialien bieten Bauherren eine große Auswahl.